
zurück
02.10.2018 Individuum und Masse
Individuum und Masse
Cornelius Meister über den Chor in „Lohengrin“
Die Chorpartien im Lohengrin gehören zu den umfangreichsten und anspruchsvollsten, damit aber auch zu den reizvollsten der gesamten Opernliteratur. In welchem Ausmaß die Tenöre ein hohes A zu singen haben, ist beispiellos – im dritten Akt folgt dann noch ein lang ausgehaltenes hohes C, das Wagner übrigens seiner Titelfigur nicht zumutet. Der emotionale Ausnahmezustand, in den die Menge durch die Ankunft eines Namenlosen gelangt ist, lässt sich in vielfältiger Weise hören. Wir hören Chöre, die auskomponiertes Staunen sind. Ich denke an Elsas ersten Auftritt, das der Männerchor mit „Seht hin! Sie naht ...“ kommentiert, oder an „Wie wunderbar! Welch’ seltsames Gebaren!“, dessen vier erste Anfangsbuchstaben w, w, w und s – allesamt klingende Konsonanten – sich bestens dafür eignen, das Staunen lautmalerisch zum Ausdruck zu bringen.
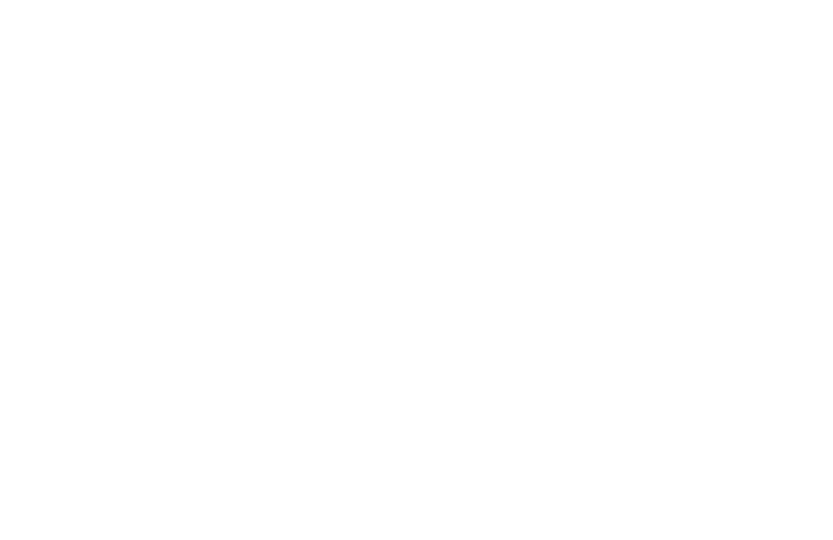
Szene aus Lohengrin © Matthias Baus
Im sogenannten Schwanenchor, in dem die Brabanter Lohengrins Ankunft bemerken („Seht! Seht! Welch’ ein seltsam Wunder!“) ist der Männerchor in zwei Chöre geteilt, deren Stimmgruppen einzelne einsilbige Wörter und kurze Sätze ausstoßen. Sie verdichten sich, werden lauter und kulminieren im kollektiven Ausruf „Ein Wunder!“, bevor im gleißenden A-Dur schließlich Lohengrin erscheint. Nicht nur hier, sondern auch im zweiten Akt („In Früh’n versammelt uns der Ruf“) sind achtstimmige Männerchöre, geteilt in zwei Gruppen, ein auffälliges Stilmittel. Der Vielstimmigkeit, die hier erreicht wird, steht eine erstaunlich einmütige Äußerung bei den Frauen im Moment ihres ersten Einsatzes gegenüber: Der Frauenchor singt erstmals, wenn Elsa 36 Staunen und Zweifeln Gott um Hilfe bittet. Auf Elsas „Herr!“ setzen die Frauen ein. Als Zuhörer bemerkt man diesen Einsatz nicht unbedingt. Es ist eher, als würde Elsas Stimme eine Verstärkung erfahren. Das sind nur einige Beispiele dafür, dass man hier nicht nur von dem einen, sich einstimmig äußernden Volk sprechen kann. Deutlich ist Wagners Bestreben, den Solistinnen und Solisten nicht eine undifferenzierte Menge gegenüberzustellen, sondern zwischen Individuum und Masse vielfältige Abstufungen zu schaffen.

Szene aus Lohengrin © Matthias Baus