
zurück
07.03.2025 Höchste Zeit für neue Heldinnen!
Höchste Zeit für neue Heldinnen!
Ach! Seit Jahrhunderten immer wieder die gleichen stereotypen Frauenfiguren auf den Opernbühnen dieser Welt: unschuldig, leidend, tragisch endend. Höchste Zeit für neue Opernheldinnen, findet Simone Theilacker-Wolter, Direktorin Künstlerische Produktion und stellvertretende Intendantin. Ein Stoßseufzer (nicht nur) zum Internationalen Frauentag.
Es ist immer das Gleiche, und das bereits seit Jahrhunderten: Die Frauenfiguren des Musiktheaters sind oft von Klischees geprägt, von traditionellen Geschlechterrollen und und stereotypen Vorstellungen von Weiblichkeit. Meistens sind sie hilfsbedürftig und leidend, werden verführt oder geopfert – und wenn sie einmal selbstbestimmt aufstehen, müssen sie erst recht sterben.
Viele Opern zeichnen Frauen als Opfer äußerer Umstände, ein Eindruck, der auch durch musikalische Mittel zusätzlich verstärkt wird. Oder warum muss ausgerechnet immer der Sopran sterben? Die Musik, die diesen Frauen zugeordnet ist, ist oft melancholisch oder tragisch, was das stereotype Bild des Opfers oder der leidenden Figur untermauert – so etwa bei Pamina in Mozarts Zauberflöte oder Violetta in Verdis Traviata. Sie und noch viele mehr werden als emotionsgetrieben, schwach oder schicksalsergeben dargestellt. Besonders der Konflikt zwischen Liebe und Pflicht wird häufig einer weiblichen Figur aufgebürdet, wodurch ihre moralische Ambivalenz betont wird. Der „Opfertod“ einer Frau bildet in vielen Opern den dramatischen Höhepunkt – ein weiteres Klischee, das die Frau zur Märtyrerin stilisiert, wie es in Tosca besonders eindrücklich zu sehen ist.
Viele Opern zeichnen Frauen als Opfer äußerer Umstände, ein Eindruck, der auch durch musikalische Mittel zusätzlich verstärkt wird. Oder warum muss ausgerechnet immer der Sopran sterben? Die Musik, die diesen Frauen zugeordnet ist, ist oft melancholisch oder tragisch, was das stereotype Bild des Opfers oder der leidenden Figur untermauert – so etwa bei Pamina in Mozarts Zauberflöte oder Violetta in Verdis Traviata. Sie und noch viele mehr werden als emotionsgetrieben, schwach oder schicksalsergeben dargestellt. Besonders der Konflikt zwischen Liebe und Pflicht wird häufig einer weiblichen Figur aufgebürdet, wodurch ihre moralische Ambivalenz betont wird. Der „Opfertod“ einer Frau bildet in vielen Opern den dramatischen Höhepunkt – ein weiteres Klischee, das die Frau zur Märtyrerin stilisiert, wie es in Tosca besonders eindrücklich zu sehen ist.
Doch die Opernbühnen beginnen sich zu wandeln – wenn auch langsamer als ich es mir erhoffen würde. Immer öfter hinterfragen Regisseur*innen stereotype Darstellungen und dekonstruieren sie. Frauenfiguren werden komplexer, vielschichtiger und selbstbestimmter gezeichnet, wodurch sich eine realistischere Auseinandersetzung mit weiblicher Identität und Rollenbildern eröffnet. Es ist höchste Zeit für neue Opernheldinnen, die Normen infrage stellen und das klassische Repertoire erweitern. Musiktheater heute muss Raum für neue Perspektiven bieten – für weibliche (Anti-)Heldinnen, die überkommene Grenzen sprengen.
Deswegen liebe ich unsere Dora so sehr, diese wütende, unerschrockene und kämpferische Titelfigur der Oper von Bernhard Lang. Sie ist eine Antiheldin, die sich deutlich von traditionellen Frauenbildern abhebt – komplex, widersprüchlich, auf der Suche nach Selbstbestimmung und einem neuen Lebensweg. Die Musik in Langs Oper ist oft dissonant, experimentell und rhythmusgetrieben, was die innere Zerrissenheit und auch die Unvorhersehbarkeit von Doras Persönlichkeit und ihren Handlungen unterstreicht. Obwohl Dora von zwei Männern – Komponist Bernhard Lang und Autor Frank Witzel – geschaffen wurde, stellt sie einen bemerkenswerten Bruch mit klassischen Frauenbildern dar und eröffnet neue Wege für weibliche Figuren auf der Opernbühne.
Deswegen liebe ich unsere Dora so sehr, diese wütende, unerschrockene und kämpferische Titelfigur der Oper von Bernhard Lang. Sie ist eine Antiheldin, die sich deutlich von traditionellen Frauenbildern abhebt – komplex, widersprüchlich, auf der Suche nach Selbstbestimmung und einem neuen Lebensweg. Die Musik in Langs Oper ist oft dissonant, experimentell und rhythmusgetrieben, was die innere Zerrissenheit und auch die Unvorhersehbarkeit von Doras Persönlichkeit und ihren Handlungen unterstreicht. Obwohl Dora von zwei Männern – Komponist Bernhard Lang und Autor Frank Witzel – geschaffen wurde, stellt sie einen bemerkenswerten Bruch mit klassischen Frauenbildern dar und eröffnet neue Wege für weibliche Figuren auf der Opernbühne.
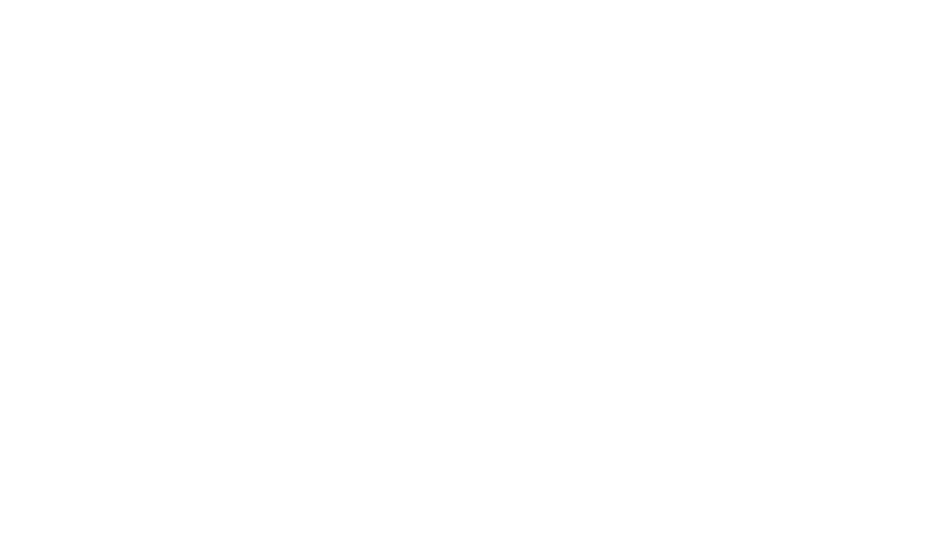
Dora: Eine Frau, die selbständig ihren eigenen Weg geht, und sich sogar mit dem Teufel anlegt.
Foto: Martin Sigmund
Foto: Martin Sigmund
Klar, die traditionellen Stoffe bleiben und das ist auch gut so, denn natürlich lieben wir die Opern von Verdi, Wagner, Strauss und allen anderen! Doch mit diesem klassischen Repertoire dominiert auch weiterhin der männliche Blick. Umso wichtiger ist es, neue Stimmen zu fördern und weibliche Perspektiven weiterzuentwickeln. Aber nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell ist noch viel zu tun im Theaterbetrieb. Eingerostete Machtgefüge, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Gleichbehandlung, an all dem wollen wir auch weiterhin arbeiten.
In diesem Sinne: einen inspirierenden und kämpferischen Internationalen Frauentag am 8. März Ihnen und uns allen!
In diesem Sinne: einen inspirierenden und kämpferischen Internationalen Frauentag am 8. März Ihnen und uns allen!
Simone Theilacker-Wolter studierte Theaterwissenschaft, Kunstgeschichte und Sozialpsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und absolvierte zusätzlich eine Weiterbildung in Kulturmanagement an der Hochschule für Musik und Theater München. Von 2008 bis 2011 war sie zunächst als persönliche Assistentin des Geschäftsführenden Direktors an der Bayerischen Staatsoper in München tätig, von 2011 bis 2013 leitete sie dort das Chorbüro. Anschließend setzte sie ihren beruflichen Werdegang für drei Spielzeiten als Leiterin des Künstlerischen Betriebsbüros des Theaters St. Gallen fort. Von der Spielzeit 2016/17 an war Simone Theilacker-Wolter zwei Jahre als Orchestermanagerin beim Jewish Chamber Orchestra Munich (ehem. Orchester Jakobsplatz München) tätig. In der Saison 2018/19 übernahm sie die Position der Direktorin Künstlerische Produktion an der Staatsoper Stuttgart und ist zudem seit März 2021 Stellvertreterin des Intendanten in administrativen Belangen.
Dora
Mär 2025
Dora
So
23
18:00 – 19:45
Opernhaus
Opernhaus
Wieder im Repertoire, Uraufführung des Jahres, Stuzubis 10 € bereits im Vorverkauf!
Besetzung
Apr 2025
Dora
Besetzung